Zum 100. Geburtstag von Sir Alec Issigonis
Die Technik des MINI Classic
Der MINI Classic kam 1959 mit einem Vierzylindermotor auf den Markt. Seine
Basis stammte aus dem Jahr 1951, als der so genannte Serie-A-Motor beim Austin
A30 und dem legendären Morris Minor erstmals eingesetzt wurde.

Mini Cooper Motorteile aus den Sechzigern
Die Kurbelwelle
rotierte in drei Lagern, die vier Brennräume dieses Basismotors wiesen insgesamt
803 ccm Hubraum auf, gut für eine Nennleistung von 28 PS. Die oben liegenden
Ventile wurden über Stößelstangen und eine unten liegende Nockenwelle betätigt,
die sich mit den Ein- und Auslasskanälen dieselbe Seite teilten. Der
Längsstrom-Zylinderkopf wies herzförmige Taschen im Brennraum auf, in denen die
Ventilöffnungen samt Zündkerze saßen. Diese Formgebung sorgte für eine
hervorragende Verwirbelung des Gemischs und damit optimale Verbrennung und
ruhigen Lauf.
Hochdrehzahlkonzept: 34 PS bei 5.500 Touren.
Als die Entwicklung des MINI Classic begann, und Issigonis nach einem
geeigneten Antrieb suchte, hatte der Serie-A-Motor bereits eine erste
Überarbeitung erfahren. Der neue Motor brachte bei einem Hubraum von 948 ccm
eine Leistung von 37 PS. Das war zuviel für Fahrwerk und Bremsen des kleinen
MINI Classic, weshalb der Hubraum des jetzt quer eingebauten Motors um 100 cm³
und damit die Leistung auf 34 PS bei 5.500 Umdrehungen pro Minute verringert
wurde. Diese Nenndrehzahl war außergewöhnlich hoch, damals erreichten lediglich
hochkarätige Sportmotoren, wie beispielsweise die eines Jaguar, auf Dauer derart
hohe Touren. Durch Hubraumerhöhungen, andere Vergaserbestückungen und letztlich
Einspritzung wiesen die letzten Exemplare des MINI Classic einen 1,3- Liter
-Motor mit einer Leistung bis zu 63 PS auf.
Neuentwicklungen im Frontantrieb.
Unterhalb der Maschine betrat Issigonis technisches Neuland: Erstmals
platzierte er das Getriebe unter dem Motor, direkt zwischen die Räder, wobei
Motor und Getriebe einen gemeinsamen Ölkreislauf hatten. Damit blieb genug Platz
in der Kleinwagenfront für den seitlichen Kühler, ebenso für Lenkung und
Nebenaggregate. Aber auch das MINI Classic Konzept eines Fronttrieblers an sich
verlangte von den BMC Ingenieuren noch Entwicklungsarbeit, war die
Kraftübertragung zu den Rädern doch immer noch ein Schwachpunkt. So neigten die
bisher üblichen Kardangelenke dazu, bei größeren Lenkeinschlägen zu verziehen
und das Fahrverhalten nachhaltig zu beeinträchtigen.

Vergrößerung des Kofferraums
beim Austin Cooper S, 1966
Das Team um Issigonis griff deshalb auf homokinetische Gelenke zurück, die im
Automobilbereich zuvor nicht eingesetzt wurden. Diese Gelenke bestanden aus
einem Kugellager, das von drei Käfigen umschlossen war, von denen zwei mit An-
bzw. Abtrieb verbunden waren. Diese Konstruktion erlaubte ausreichende
Lenkwinkel ohne allzu starke Einflüsse auf Lenk- und Fahrverhalten. Um die
Belastungen der leichten und kompakten Karosserie zu verringern, lagerten die
Ingenieure den gesamten Triebstrang, Lenkung und Aufhängung in einem
Hilfsrahmen. Auch die hinteren Einzelräder waren an einem Hilfsrahmen befestigt,
was dem MINI Classic eine hervorragende Spurtreue bescherte.
Einfach ideal: Gummifederung.
Das Fahrwerk des MINI Classic war ohnehin ein technisches Highlight. Statt
Schrauben-, Torsions- oder Blattfedern konstruierte Alesc Issigonis den MINI
Classic mit einer Gummifederung. Dazu diente ein Gebilde aus zwei Kegeln mit
einer Gummischicht dazwischen. Der obere Kegel war fest mit dem Hilfsrahmen
verschraubt, der untere mit dem Radträger. Weil sich Gummi mit zunehmendem Druck
verhärtet, hatte der MINI Classic damit eine progressive Federung. Dieses
Federsystem hatte so gute Eigenschaften, dass klein dimensionierte
Teleskopstoßdämpfer ausreichten. Um ein möglichst feines Ansprechverhalten zu
erzielen, waren sie außen an den oberen Querlenkern vorn und den hinteren
Längslenkern befestigt.
Eingebaute Niveauregulierung: Hydrolastik.
1964 präsentierte Issigonis in punkto Fahrwerkstechnik eine weitere
außergewöhnliche Lösung und applizierte die neue Hydrolastik-Federung aus den
BMC-Limousinen auch für den MINI Classic. Charakteristisch für diese
einzigartige Federung waren je ein Zylinder vom Format einer Einliter-Öldose pro
Rad.
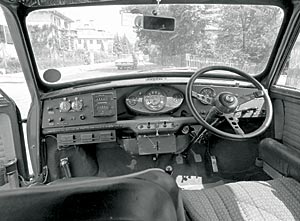
Amaturenbrett des Mini Cooper S, mit dem Hopkirk/Crellin die
Österreich-Rallye 1966 gewinnen
In diesem Zylinder waren Federung und Dämpfung zusammengefasst, wobei als
Dämpfungsmedium eine frostsichere Wasseremulsion diente. Der Clou des Hydrolastic-Systems war freilich die Verbindung der Hydraulikkammern jeweils
seitenweise von Vorder- und Hinterraddämpfer per Druckschlauch. Der Effekt: Fuhr
das Vorderrad über eine Unebenheit, wurde ein Teil der Dämpferhydraulik an die
Partnerkammer an der Hinterachse gedrückt und hob dort die Karosserie ein Stück
weit an. Natürlich funktionierte das auch im umgekehrten Fall. Theoretisch
sorgte dies für ein ständig gleichbleibendes Fahrzeugniveau. Praktisch hatte es
jedoch auch signifikante Nachteile: Saßen im Fond eines MINI Classic
schwergewichtige Passagiere und war vielleicht auch noch der Kofferraum prall
gefüllt, drückte das einsinkende Heck den Vorderbau nach oben. 1971 verschwand
dann auch die Hydrolastic wieder aus dem MINI Classic.
140 Kilo purer Leichtbau: Die Rohkarosserie.
Ein Paradebeispiel für Leichtbau war die Karosserie: Obwohl der Rohbau
lediglich 140 Kilo auf die Waage brachte, wies die Blechkonstruktion eine für
damalige Verhältnisse vorbildliche Torsionssteifigkeit auf. Dafür sorgten in
Längsrichtung die beiden Schweller und ein leichter Tunnel in Wagenmitte, der
die Abgasanlage aufnahm, und die Radkästen. In Querrichtung waren es die robuste
Spritzwand zwischen Motorraum und Fahrgastzelle, eine Quertraverse unter den
Vordersitzen und die Kofferraumwand. Die hohe Stabilität erlaubte sogar schlanke
Dachholme mit großen Fensterflächen. Und nach 32 Jahren sogar noch die
Entwicklung eines Cabriolets.
Quelle: BMW Presse-Information vom 15.11.2006
|

















