Im Jahr 2000 erschien die dritte Generation des BMW M3, diesmal auf Basis des
Coupés der Baureihe E46. Die dritte Ausgabe des weltbekannten Sportwagens aus
München überzeugte vom Start weg durch mehr Leistung, mehr Dynamik und mehr
Eigenständigkeit im Design gegenüber anderen BMW 3er Modellen. Bereits nach den
ersten Tests in der Fachpresse war klar, dass der BMW M3 zuallererst ein
besonders leistungsfähiges Sportcoupé
der Extraklasse darstellt.
Athletisch gebaut und elegant im Ausdruck.
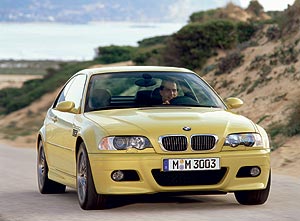
BMW M3, Modell E46, Coupé, 2000
Im Design liegt dieser BMW M3 auf einer Linie mit der ersten Generation, auch
wenn er nicht auf Spoiler und markante Kotflügelverbreiterungen setzt. Dank
einer neuen Frontschürze mit integrierten Nebelscheinwerfern in Ellipsenform und
großen Lufteinlässen unterscheidet sich das Modell deutlich von allen anderen
Versionen der BMW 3er Reihe.
Die Fronthaube besteht aus Aluminium und ist im Vergleich zu einer
Stahlblechhaube um rund 40 Prozent leichter. Das Besondere dabei: Trotz des
Gewichtsvorteils erfüllt die Klappe in den Disziplinen Steifigkeit und
Crashsicherheit dieselben Anforderungen wie die Stahlblechhaube des
Basis-Coupés.
Die Motorhaube des BMW M3 besitzt darüber hinaus ein charakteristisches
Markenzeichen, über das sich das Fahrzeug von anderen Modellen der
BMW 3er Reihe abhebt: den so genannten Powerdome. Unter dieser leichten
Ausformung in der Haubenmitte verbirgt sich das neue BMW M3 Aggregat.
Charakteristisch für den gesamten Auftritt ist, dass kein Designelement bloßen
Showcharakter hat. Alle Modifikationen gegenüber der Serie folgen streng der
Funktion und hohen ästhetischen Anforderungen.
Die Seitenansicht der BMW M3-Karosserie einschließlich der Radläufe zeigt sich
deutlich verbreitert gegenüber dem Serien-Coupé (plus 20 Millimeter), mit Kiemen
und M3 Emblem in den vorderen Seitenwänden. Notwendig wurde die breitere
Karosserie, um sowohl eine größere Spurweite, als auch adäquate Räder und Reifen
unterzubringen. Diesen starken optischen
Auftritt unterstreichen die neuen M Außenspiegel, asphärisch ausgeführt und bei
Bedarf (als Sonderausstattung) elektrisch anklappbar, seitliche
Schwellerverkleidungen sowie am hinteren Abschluss des Wagens eine aerodynamisch
optimierte Heckschürze samt Heckspoiler-Lippe.
Eine doppelflutige Abgasanlage mit vier Endrohren lässt erahnen, in welcher
Leistungsklasse dieses Fahrzeug antritt.
Motor mit mehr Leistung dank Hochdrehzahlkonzept.
Der Motor des neuen BMW M3 verleiht der Charakterisierung „turbinenartige
Kraftentfaltung und Laufruhe“, die weltweit längst zum Inbegriff der
Sechszylinder von BMW geworden ist, eine völlig neue Bedeutung. Das neu
entwickelte Triebwerk mit einem Hubraum von 3.246 Kubikzentimetern brachte das
aus der Formel 1 bekannte und für die Serienproduktion weiterentwickelte
Hochdrehzahlkonzept in den BMW M3. Bei einer Drehzahl von 8.000 U/Min. erreichen
die Kolben des neuen Motors eine Geschwindigkeit von mehr als 20 Metern in der
Sekunde und bewegen sich damit nur unwesentlich langsamer als die Kolben eines
Formel 1-Motors. Kein anderes Aggregat hat solche Leistungsdaten vorzuweisen:
252 kW/343 PS bringen die 1570 Kilogramm des Sportwagens in nur 5,2 Sekunden von
null auf 100 km/h. Der überragende Wirkungsgrad in allen Drehzahl- und
Lastbereichen garantiert im Praxisbetrieb einen günstigen Kraftstoffverbrauch
sowie geringe Abgasemissionen.

BMW M3, Modell E46, Motor, 2003
Die Weiterentwicklung des Hochdrehzahlkonzepts war aber nur ein Grund für die
Neuentwicklung des Motors. Die Ingenieure hatten eine ganze Liste von
Anforderungen, die das neue Aggregat erfüllen musste. Gewichtsersparnis, mehr
Drehmoment und Leistung sowie ein großer nutzbarer Drehzahlbereich waren genauso
wichtige Ziele wie der weltweite Einsatz des Motors.
Gerade der letzte Punkt stellte die Ingenieure vor eine große Herausforderung,
denn der Motor musste sämtliche gesetzlichen Vorgaben in den Bereichen
Abgasverhalten und Geräuschentwicklung erfüllen, die es in den zahlreichen
Verkaufsländern gab und gibt.
Durch die hohen spezifischen Kennwerte des Hochleistungsmotors konnte das
Entwicklungsteam in diesem Fall kaum auf Serienteile zurückgreifen,
wie es bei der ersten Generation im Jahr 1985 möglich gewesen war. Lediglich die
Ölwannendichtung, die Spannrolle für die Aggregateriemen,
die hinteren Kurbelwellenabschlussdeckel mit Dichtung sowie der Öldruck-
und Wassertemperatursensor wurden unverändert übernommen.
Vom Vorgängermotor blieben die Maße und das Quasitrockensumpfsystem.
Dank der Ingenieurskunst erfüllt das neue Aggregat alle Anforderungen.
Im Vergleich zum leichten Vorgängermotor gelang es den Motorspezialisten sogar,
das Gewicht um weitere 6 Prozent zu senken. Ferner verlagerten
sie den Schwerpunkt des Motors nach unten, was die Fahrdynamik positiv
beeinflusst.
Allein schon wegen der höheren Drehzahlen und der komplexeren Funktionaldaten
mussten die Ingenieure auch ein neues Motorsteuergerät entwickeln: das MSS 54.
Dieses Mehrprozessorsystem steuerte, wie bereits beim Vorgänger, zwei
32-bit-Microcontroller und zwei Timingcoprozessoren,
jedoch mit höherer Taktfrequenz. Insgesamt liegt die Rechenleistung des neuen
Steuergerätes jetzt bei 25 Millionen Berechnungen pro Sekunde.
Wie wichtig und komplex die Aufgaben dieser Einheit für die gesamte Funktion des
Motors sind, zeigen allein die unterschiedlichen Bereiche,
in die das Mehrprozessorsystem eingreift: Es überwacht die Regelung der
Spreizung für Ein- und Auslassnockenwelle (Doppel-VANOS) genauso
wie das Ölniveau, die Wegfahrsperre oder die elektronische
Drosselklappenregelung. Zylinderindividuell errechnet es für jeden Arbeitstakt
abhängig von Last und Drehzahl den Zündzeitpunkt, die Einspritzmenge und den
Einspritzzeitpunkt. Zusätzlich liefert es über ein aufwändiges Diagnosesystem
Informationen bei der Wartung.
Perfekte Motorsteuerung dank einer Eigenentwicklung.
Die zylinderselektive, adaptive Klopfregelung erhält ihr Klopfsignal
über drei Körperschallsensoren, jeweils ein Sensor überwacht zwei Zylinder.
Die Adaption erfolgt für jeden Zylinder über eine arbeitspunktabhängige
Normierung und erlaubt es, im gesamten Zündwinkelkennfeld die besten Zündwerte
zu programmieren. Über einen Schalter am Armaturenbrett
kann der BMW M3 Fahrer eine sportlichere, das heißt progressivere Kennlinie
bezüglich Gaspedalweg und Drosselklappenöffnung abrufen.

BMW M3, Modell E46, Coupé, 2000
Die Steuerung der elektronischen Drosselklappenregelung basiert auf einer so
genannten Momentenstruktur. Dies bedeutet, dass der Fahrerwunsch jeweils über
das Potentiometer am Gaspedal gemessen und in ein Wunschmoment übersetzt wird.
Im Momentenmanager wird dieses Wunschmoment um
die Bedarfsmomente der Nebenaggregate korrigiert und mit den geforderten
Maximal- beziehungsweise Minimalmomenten der Dynamischen
Stabilitäts Control (DSC) und der Motor-Schleppmomenten-Regelung (MSR)
abgeglichen. Das so berechnete Sollmoment wird dann unter Berücksichtigung des
aktuellen Zündwinkels eingestellt. Für den Fahrer führt dies dazu, dass der
Motor ihm quasi seinen Fahrstil vom Fuß abliest und die entsprechende Leistung
kurzfristig bereitstellen kann.
Optimale Gaswechsel durch variable Nockenwellenspreizung.
Die Variable Nockenwellenspreizung für Ein- und Auslassnockenwelle (Doppel-VANOS),
ein System dessen erste Version im BMW M3 im Jahr 1992 Weltpremiere feierte,
sorgt auch im Motor des aktuellen BMW M3 wieder
für optimale Gaswechsel. In der Praxis bedeutet dies mehr Leistung, weniger
Verbrauch und schadstoffarmes Abgas.
Das Funktionsprinzip der VANOS-Technologie ermöglicht eine jederzeit
situationsgerechte Steuerung. Das über eine Duplexkette mit der Kurbelwelle
verbundene Kettenrad ist durch die axial verschiebbare, schräg verzahnte Welle
mit der Nockenwelle verbunden. Bei axialer Verschiebung der Welle
ergibt sich durch die Schrägverzahnung eine radiale Relativbewegung zwischen
Nockenwelle und Kettenrad. Dies ermöglicht, den Spreizungswinkel der
Einlassnockenwelle um 60 Grad und der Auslassnockenwelle um
46 Grad zu variieren. Die axiale Verstellung der Zahnwelle erfolgt über einen
Verstellkolben.
Das Motoröl wird durch eine in das VANOS-Gehäuse integrierte Radialkolbenpumpe
auf einen Arbeitsdruck von 115 bar vorgespannt.
Die kennfeldgesteuerte Hochdruckverstellung garantiert kurze Verstellzeiten und
somit für jeden Betriebspunkt last- und drehzahlabhängig den
optimalen Spreizungswinkel synchron zu Zündzeitpunkt und Einspritzmenge.
Ein Motor für alle.

BMW M3, Modell E46,
Motor (343 PS), 2000
Erstmals kommt mit dem neu entwickelten Reihensechszylinder mit 3.246
Kubikzentimetern Hubraum ein Motor zum Einsatz, der in allen Ländervarianten
verbaut werden kann. Anders als bei der 252 kW/343 PS starken ECE-Version wird
er allerdings für die US-Ausführung des BMW M3 auf 333 HP (249 kW/338 PS)
gedrosselt. Bei einem Hubraumzuwachs von nur 1,4 Prozent im Vergleich zum
Vorgängermodell stiegen die Nennleistung dennoch um 6,9 und das Drehmoment um
4,3 Prozent. Der Kraftzuwachs ist eine direkte Folge des Hochdrehzahlkonzeptes.
Durch konsequente Ladungswechselabstimmung und Entdrosselung erhöhte sich die
spezifische Leistung von 100 auf knapp 106 PS pro Liter. Trotz der hohen
Nenndrehzahlen bietet der Motor ein großes nutzbares Drehzahlband.
Bereits bei 2.000 U/Min. entwickelt er 80 Prozent seines maximalen Drehmoments.
Dieser Motor begeisterte von Beginn an auch die Fachwelt:
So bekam er von 2001 bis 2006 sechs Mal die begehrte Trophäe
„Engine of the Year“ verliehen, eine besondere Auszeichnung.
Außergewöhnliche Technik für ein außergewöhnliches Auto.
Die hohe Fahrdynamik war Grund dafür, dass zahlreiche Systeme aufwändiger
ausgelegt werden mussten als in einem normalen Straßenfahrzeug.
Dazu gehört die Schmierölversorgung des Motors über eine
Quasitrockensumpfschmierung. Aufgrund der Sumpfanordnung und des um 30 Grad nach
rechts geneigt eingebauten Motors konnte bei hoher Querbeschleunigung in
Linkskurven sowie bei starkem Verzögern das Öl nicht in den Sumpf zurücklaufen.
Deshalb wurde die Druckölpumpe mit einer Rückförderpumpe gekoppelt, die das Öl
rechts aus dem vorderen kleinen Ölsumpf absaugt
und in den hinteren großen Ölsumpf fördert. Der hintere Ölsumpf ist praktisch
komplett geschlossen, die Rücklauföffnungen und der Absaugpunkt
der Druckölpumpe sind auf die auftretenden Beschleunigungen hin genau
abgestimmt.
Schneller als der Motor: Das Fahrwerk.
Viel Augenmerk legten die Techniker auf die Fahrwerksentwicklung.
Getreu dem Motto „Das Fahrwerk ist immer schneller als der Motor“ wurden hohe
Ansprüche gestellt, und aufgrund des Hochdrehzahlkonzepts und
der Leistungsfähigkeit des BMW M3 Motors standen die Fahrwerksingenieure vor
keiner leichten Aufgabe. Allerdings konnten sie auf einer hervorragenden Basis
aufbauen: Das Fahrwerk des BMW M3 der dritten Generation ist eine konsequente
Weiterentwicklung des Vorgänger-Fahrwerks. Dessen Fahreigenschaften gelten nach
wie vor als Benchmark im Sportwagensegment, beispielsweise als „Best Handling
Car“ für die Experten des US-Magazins „Car and Driver“. Die sehr steife
Karosserie des BMW 3er Coupé, der hohe Anteil an leichten
Aluminium-Achsbauteilen sowie die ausgewogene Gewichtsverteilung auf Vorder- und
Hinterachse von nahezu 50 : 50 waren eine ideale Voraussetzung für ungetrübte
Fahrfreude mit dem BMW Standardantrieb auf die Hinterräder. Trotz geringfügig
höherer Fahrzeugmaße und -abmessungen gelang es den Fahrwerksingenieuren, bei
unverändert guter Alltagstauglichkeit die Handlingeigenschaften des Vorgängers
nochmals zu überbieten.
DSC und M Differenzialsperre helfen bei der Traktion.
Mit der Einführung der dritten Generation des BMW M3 zählt die Dynamische
Stabilitäts Control (DSC) zum serienmäßigen Lieferumfang. Durchdrehende Räder
auf nasser Straße oder im Schnee gehören damit der Vergangenheit an. Allerdings
konnten die Ingenieure nicht einfach das DSC System aus
der Serie übernehmen, sondern mussten auch in diesem Bereich wegen der enormen
Kräfte, die der BMW M3 freisetzt, Anpassungen ausarbeiten. Speziell das spontane
Ansprechverhalten des BMW M3 Motors und die kurze Achsübersetzung erforderten
zahlreiche Neuprogrammierungen.

BMW M3 GTR, Modell E46,
Rennversion 2004
Differenzialsperren an den Hinterrädern gehören von Beginn an zur
Serienausstattung aller BMW M Fahrzeuge. In der nun dritten M3-Generation wurde
das bisher verbaute und drehmomentfühlende Selbstsperrdifferenzial mit einem
Sperrwert von 25 Prozent durch eine Neuentwicklung ersetzt. Diese verfügt über
einen variablen Sperrwert zwischen 0 und 100 Prozent. Unter dem Namen Variable M
Differenzialsperre unterstützt den Fahrer
damit jetzt eine Sperre, die in der Lage ist, selbst bei sehr anspruchsvollen
Fahrsituationen und daraus resultierenden unterschiedlichen Reibwerten
an den Antriebsrädern einen entscheidenden Traktionsvorteil zu liefern.
In Kombination mit dem DSC System erlangt der BMW M3 somit
Winterfahreigenschaften, die bisher bei heckgetriebenen Sportwagen nicht möglich
erschienen.
Hochleistungsbremsen und M Power.
Wo viel Kraft ist, sollte auch viel Bremskraft sein. Deshalb erhielt der BMW M3
eine üppig dimensionierte Hochleistungs-Bremsanlage, so genannte schwimmend
gelagerte Compound-Bremsen. Der innenbelüftete Reibring der Bremsscheibe ist
dabei über eingegossene Edelstahlstifte schwimmend
mit dem Scheibentopf aus Aluminium verbunden. Die Beanspruchung der Bremsscheibe
durch thermische Spannungen wird dadurch deutlich
reduziert und die Lebensdauer der Bremsscheibe erhöht. Die Perforation des
Reibringes reduziert das Gewicht der Bremsscheiben zusätzlich,
pro Vorderrad um 0,7 Kilogramm und pro Hinterrad um 0,8 Kilogramm im Vergleich
zu herkömmlichen einteiligen Bremsscheiben.
Dank großer, gelochter Grauguss-Bremsscheiben (Durchmesser/Stärke
vorn: 325/28 Millimeter, hinten: 326/20 Millimeter) wurden beeindruckende
Verzögerungswerte möglich: Unterstützt durch einen 9-/10-Zoll-Tandem-Booster
erreicht der BMW M3 Verzögerungswerte von rund 11 m/s2,
aus Tempo 100 liegt der Bremsweg bei 35 Metern. Damit behauptet sich
der BMW M3 auch in Sachen Bremsleistung eindrucksvoll im Segment hochkarätiger
Sportwagen.
Mehr als nur ein BMW M3 im Angebot.
Ein Jahr nach Einführung des BMW M3 auf Coupé-Basis präsentierte
die BMW M GmbH im Jahre 2001 bereits die Cabrioversion auf Basis der Baureihe
E46. Obwohl bis zur A-Säule identisch mit der geschlossenen Variante, besitzt
dieses Auto eine hohe Eigenständigkeit. Die prägnante Gürtellinie und der
Cabrio-Charakter lassen es noch breiter und kraftvoller erscheinen. Insgesamt
wirkt das BMW M3 Cabrio muskulöser und flacher
als die geschlossene Variante, mit der es selbstverständlich alle technischen
Finessen teilt.

BMW M3 GTR, Modell E46,
Rennversion, 2005
Es geht allerdings noch etwas exklusiver, wie BMW im Herbst des Jahres 2001
zeigte. Mit dem BMW M3 GTR wurde eine überarbeitete Straßenvariante des BMW M3
präsentiert, der in der American LeMans Series (ALMS) von Sieg zu Sieg eilte. Ab
Februar 2002 war der von 330 kW/460 PS auf 258 kW/350 PS gedrosselte
Straßenrenner zum Preis von rund
250 000 Euro zu erwerben. Technisch war die zivile Version sehr eng an die
Rennversion angelehnt. Unter der Motorhaube mit zusätzlichen Kühlschlitzen
verrichtete ein V8-Hochleistungsmotor mit Trockensumpfschmierung
seinen Dienst. Ebenfalls mit an Bord waren ein Sechsgang-Handschaltgetriebe
sowie eine Zweischeibenkupplung, wie sie im Rennfahrzeug verwendet wurde. Auch
die Karosserie war der Rennversion ähnlich: Aus Gründen der Gewichtsersparnis
bestanden das Dach, der Heckflügel sowie die Front-
und Heckschürze aus kohlefaserverstärktem Kunststoff.
Das 110-Prozent-Auto.
Im Jahr 2003 brachte BMW die Serienversion eines Concept Cars auf den Markt, das
schon auf der Internationalen Automobilausstellung 2001 in Frankfurt für
Aufsehen gesorgt hatte: den BMW M3 CSL. Das Kürzel stand für Coupé, Sport und
Leichtbau. Eine Tradition, die bei BMW bis in die 1930er Jahre zurückreicht, als
das legendäre BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé entstand. Die Ingenieure
interpretierten jedoch das alte Thema auf neue
Art und Weise. Im Vordergrund stand bei diesem Fahrzeug keine radikale
Abmagerungskur durch das Entfernen einzelner Komponenten. Vielmehr setzten sie
auf intelligenten Leichtbau, also die Gewichtsreduzierung durch den Einsatz der
am jeweils besten geeigneten Werkstoffe an der richtigen Stelle. Insgesamt
konnten die Experten den BMW M3 um gut 110 Kilogramm abspecken, so dass er in
der CSL-Variante lediglich 1 385 Kilogramm auf
die Waage brachte. Auch der Motor wurde einer Überarbeitung unterzogen und
leistete in dieser Version 265 kW/360 PS. Daraus resultierte
ein Leistungsgewicht von nur 3,85 Kilogramm pro PS – ein geradezu sensationeller
Wert, der den BMW M3 CSL im Vergleich zum serienmäßigen BMW M3 noch agiler
auftreten ließ. Den klassischen Sprint aus dem
Stand auf 100 km/h schaffte er in nur 4,9 Sekunden. Von null auf Tempo 200
benötigte er nur 16,8 Sekunden. Seine Höchstgeschwindigkeit wurde elektronisch
auf 250 km/h limitiert.
Fahrer des BMW M3 CSL profitieren von weiteren technischen Hilfen,
die serienmäßig mit an Bord sind: das Sequentielle M Getriebe mit
Drivelogic und dem M Track Mode. Das Getriebe ermöglicht überaus schnelle
Gangwechsel (bis zu 0,08 Sekunden) in bester Formel 1-Manier über Schaltwippen
am Lenkrad. Die integrierte Launch Control sorgt – wie bei allen mit dem SMG
ausgestatteten BMW M3 – dafür, dass der Wagen aus dem Stand bis zur
Höchstgeschwindigkeit beschleunigt, ohne dass der Fahrer sich um die Gangwechsel
oder Drehzahlbegrenzungen kümmern muss.
Mit dem M Track Mode kam ein eigens für den Rennsport entwickelter spezieller
Modus des DSC hinzu. Optische Anzeigen im Armaturenbrett versetzen den Fahrer
auf der Rennstrecke in die Lage, die Längs- und Querbeschleunigung innerhalb der
physikalischen Grenzen so weit es geht zu nutzen. Das DSC greift erst im
absoluten Grenzbereich in das Geschehen ein.
Tuning für das Basismodell.

BMW M3 Cabrio, Modell E46, 2002
Zum Beginn des Jahres 2005 wartete BMW mit einem besonderen Schmankerl auf: dem
so genannten Competition Paket. Zum Preis von
5.300 Euro konnte bei der Bestellung eines Neufahrzeuges diese Zusatzausstattung
geordert werden, die den BMW M3 im Handling noch direkter und sportiver
auftreten ließ. In dem Paket enthalten sind 19 Zoll-Räder, die dem Styling der
Felgen des BMW M3 CSL entsprechen und mit
Sport-Cup-Reifen bestückt sind. In Verbindung mit einem insgesamt optimierten
Fahrwerk und einer noch direkter ausgelegten Lenkung (Übersetzung 14,5 : 1
statt15,4 : 1) ergibt sich daraus ein merklich agileres Fahrverhalten.
Dank des Sonderpakets kamen auch Fahrer der BMW M3 Basisversion in den Genuss
des M Track Mode aus dem BMW M3 CSL. Für eine entsprechende Verzögerung gehörte
die Bremsanlage des BMW M3 CSL ebenfalls mit zum Paket.
Auch in der dritten Generation steht der BMW M3 bei den Kunden ebenso hoch im
Kurs wie seine Vorgänger. Bis zum Sommer 2006 wurden insgesamt 85139 Einheiten
ausgeliefert, darunter 29:633 Cabrios.
Quelle: BMW Presse-Information vom 06.07.2007

















